Wann haftet die Behörde auf Schadensersatz wegen Amtspflichtverletzung bei fehlerhafter Beratung?
Die Anspruchsgrundlage ist § 839 BGB. Maßstab für die Beratung ist u. a. § 14 SGB I (ggf. ergänzend § 15 SGB I).
Der BGH hat die Anforderungen an Richtigkeit, Vollständigkeit und Klarheit behördlicher Auskünfte konkretisiert (III ZR 466/16).
1. Überblick & Abgrenzung
Schadensersatzansprüche wegen fehlerhafter Beratung stützen sich auf § 839 BGB. Sie sind vom sozialrechtlichen Herstellungsanspruch zu unterscheiden: Dort geht es verschuldensunabhängig um Naturalrestitution (rechtmäßige Amtshandlung nachholen); hier um Geldersatz und es braucht Verschulden.
2. Voraussetzungen der Amtshaftung (§ 839 BGB)
- Amtspflichtverletzung: Auskunft/ Beratung muss dem Stand der Erkenntnismöglichkeit entsprechen: vollständig, richtig, unmissverständlich (BGH-Linie); Maßstab u. a. § 14 SGB I.
- Drittbezogenheit: Die Pflicht muss dem Geschädigten gegenüber bestehen.
- Verschulden: Vorsatz oder Fahrlässigkeit.
- Kausalität zwischen Fehlberatung und Schaden.
- Subsidiarität (§ 839 Abs. 1 S. 2 BGB): Kein Ersatz, wenn der Schaden auf andere Weise ausgeglichen werden kann (z. B. durch Naturalrestitution).
3. BGH 02.08.2018 – III ZR 466/16 (Kernaussagen)
Auskünfte müssen vollständig, richtig, eindeutig sein, damit der Bürger verlässlich disponieren kann. Besteht erkennbarer rentenrechtlicher Beratungsbedarf, sind Hinweise zu geben (z. B. auf Antragstellung).
Quelle: BGH, 2. August 2018 – III ZR 466/16.
Im Fall verneinte die DRV eine rückwirkende Rentenzahlung wegen § 99 SGB VI. Der entstandene Schaden (u. a. entgangene Rentenleistungen) konnte nicht durch rechtmäßige Amtshandlung beseitigt werden — es blieb der Amtshaftungsweg.
4. Verhältnis zur Naturalrestitution (Herstellungsanspruch)
Amtshaftung ist nachrangig, wenn der Schaden auf andere Weise ausgleichsfähig ist (z. B. über den Herstellungsanspruch).
Ist eine rechtmäßige Nachholung nicht (mehr) möglich — etwa wegen § 99 SGB VI oder wegen Vierjahresgrenze analog § 44 Abs. 4 SGB X — kommt Schadensersatz in Betracht.
Zur Systematik und Rechtsprechung des Herstellungsanspruchs siehe die vertiefenden Beiträge unten (IDs 3425 & 11810).
5. Praxis: Darlegung & Beweis
- Dokumentation: Gesprächsnotizen (Datum, Inhalt, Ansprechpartner), Merkblätter, Schreiben, E-Mails.
- Beratungsbedarf/-bitte belegen; ggf. Erkennbarkeit des Beratungsanlasses durch Aktenlage.
- Kausalverlauf konkret darlegen: „Bei richtiger Belehrung hätte ich …, wodurch …“.
- Subsidiarität prüfen: Warum ist Naturalrestitution nicht möglich (z. B. § 99 SGB VI, analoge Vierjahresgrenze § 44 Abs. 4 SGB X)?
6. Häufige Fragen
Reicht eine ungenaue Auskunft für Amtshaftung?
Kommt auf den Einzelfall an: Bei erkennbar fehlender Sachkunde muss die Auskunft klar, richtig, vollständig sein. Unklare Hinweise können eine Pflichtverletzung begründen (vgl. BGH III ZR 466/16).
Warum zuerst den Herstellungsanspruch prüfen?
Weil § 839 Abs. 1 S. 2 BGB den Nachrang des Schadensersatzes anordnet. Ist Naturalrestitution möglich, scheidet Amtshaftung regelmäßig aus.
Gegen wen richtet sich die Klage?
Gegen den Rechtsträger der Behörde (Land/Kommune) nach den Amtshaftungsregeln; Details sind landesrechtlich/prozessual zu beachten.
7. Weiterführende Beiträge & Rechtsgrundlagen
Weiterführend zu Herstellungsanspruch, Rechtsprechung & Abgrenzung:

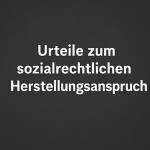

Fragesteller says
Sehr geehrter Herr Nippel,
Unter der Annahme, dass der Kläger vor dem Beratungsfehler wegen seiner Bedürftigkeit eine Grundsicherung im Alter erhalten hat, bzw. die Bedarfsgemeinschaft ggf. ALG II bezogen hat, gehe ich davon aus, dass die Anrechnungsregelungen wie bspw. § 82 SGB XII greifen. Macht ein Kläger jetzt Ansprüche wie im oben genannten Sachverhalt geltend, ist, so vermute ich, der Schaden auf den tatsächlichen finanziellen Nachteil beschränkt.
1. Kann Wohngeld, als andere Sozialleistung, die anstelle einer Grundsicherung hätte gezahlt werden können, sich positiv auf die Schadenssumme auswirken, sodass der Schaden in der Differenz zwischen bspw. ALG und Rente wg. EU + Wohngeld, obwohl zu keinem Zeitpunkt ein Antrag auf Wohngeld gestellt worden ist?
2. Welche Partei muss in einem Verfahren diese tatsächliche Verrechnung belegen? Angenommen der Beratungsfehler erfolgte erstmals 2006 und ist vor Gericht nicht streitig. Muss die Klägerpartei beweisen, dass Sie keine solchen Leistungen bezogen hat, oder muss die Beklagte beweisen, in welchen Zeiträumen Leistungen bezogen wurden, sodass sich wegen der weit zurückliegenden Sozialdaten, die nicht mehr vorliegen, Beweisschwierigkeiten ergeben, die wem zugute fallen? Wie weit ist hier das Ermessen des Richters eine Beweislast umzukehren?
3. Inwieweit kann die Klägerpartei geltend machen, dass die Beklagte bestimmte Sozialdaten als Beweis nicht in das Zivilverfahren einbringen darf, wenn Sie nach möglichen gesetzlichen Regelungen diese Daten bereits hätte löschen müssen? Welche Rolle spielt dabei ggf. eine besonders überlange und rechtswidrige Speicherung von Daten?
Vielen Dank!
Rechtsanwalt S. Nippel says
Hallo Fragesteller,
1. Was ist mit „positiv auf die Schadenssumme auswirken“ gemeint? Der Bezug von Wohngeld sollte höher ausfallen als der bloße Bezug von Leistungen zur Grundsicherung. Dann könnte auch ein Schaden höher sein, wenn im Ergebnis keine Leistungen gewährt wurden (aber ein Anspruch auf Leistungen bestand und eine entsprechende Aufklärungspflicht bestand).
2. Meines Erachtens muss der Kläger die für ihn günstigen Umstände darlegen und beweisen. Dies dürfte jedenfalls bei substantiiertem Bestreiten durch die Behörde gelten. Dann müsste der Kläger wohl darlegen und beweisen, dass und in welcher Höhe ein Schaden entstanden ist.
3. Die Löschung von Sozialdaten in der Datenverarbeitung (sowohl digital als auch in Papierform) ist „ein weites Feld“. Ob allerdings ein Anspruch auf Löschung besteht, wenn aus den Daten eine ungeklärte Sachlage „klärbar“ wäre, vermag ich nicht zu beurteilen. Möglicherweise greift § 84 Abs. 1 und 2 SGB X:
Mit freundlichen