Wann kann und wann soll eine lebenserhaltende Maßnahme begonnen oder auch abgebrochen werden?
Was ist eine „lebenserhaltende Maßnahme“?
Die vorstehenden Fragen treffen Patienten und deren Angehörige oft unvorbereitet. Der Patient wurde in einen schweren Unfall verwickelt. Der Patient erlitt einen schweren Schlaganfall. Zahlreiche weitere Sachverhalte können dazu führen, dass die Einleitung lebenserhaltender Maßnahmen in Betracht gezogen werden muss.
Zu den lebenserhaltenden Maßnahmen gehören insbesondere die künstliche Beatmung, das Legen einer PEG-Sonde (Bauchsonde), die Reanimation, eine Operation, eine Infusion zur Flüssigkeitszufuhr, …
Der Arzt muss vor einem solchen körperlichen Eingriff eine Einwilligung des Patienten einholen. Ohne wirksame Einwilligung begeht der Arzt eine strafbare Körperverletzung gemäß den §§ 223 ff. StGB.
I. Patientenwille
Was bedeutet „Patientenwille“?
Von zentraler Bedeutung für eine wirksame Einwilligung zu einer lebenserhaltenden Maßnahme ist zunächst der Patientenwille.
Der Patient sollte sich möglichst klar zu einem beabsichtigten Eingriff in seinen Körper äußern können.
Genau dies – die Äußerung eines klaren Willens – ist aber oft nach einem schweren Unfall oder einem schweren Schlaganfall nicht oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten und Unsicherheiten möglich. Auch die korrekte Erfassung und Interpretation einer Äußerung kann dann mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein.
Eindeutig ist der Fall, wenn der Patient in einem dauernden schweren Koma liegt. Der Patient kann dann seinen Willen nicht (mehr) äußern.
Weniger eindeutig kann dies aber schon nach einem Schlaganfall sein. Möglicherweise ist dann das Sprachvermögen ganz oder teilweise aufgehoben. Eine Unterschrift kann der Patient selbst nicht mehr leisten. „Bewusstseinsklarheit“ und schematisches Denken ist in derartigen Situationen bei dem Patienten und auch bei Dritten nur erschwert erkennbar. Der Arzt muss dann abwägen und in Eilsituationen ggf. den mutmaßlichen Willen des Patienten berücksichtigen. Er muss allerdings – liegt eine „eilige Behandlungsbedürftigkeit“ nicht vor – grundsätzlich eine wirksame Einwilligung einholen. Ansonsten begeht er eine Körperverletzung.
II. Einwilligungsfähigkeit
Wann ist ein Patient „einwilligungsfähig“?
Ärzte und Angehörige müssen sich oft die Frage stellen, was der Patient will und tappen dabei im Dunkeln.
Möglicherweise kann sich der Patient zwar äußern, er kann aber die Tragweite seiner Entscheidung nicht oder nur eingeschränkt erfassen. Was zählt dann? Welcher Wille ist maßgeblich? Der Wille des Arztes? Der Wille des Patienten? Der Wille der Angehörigen?
Es gilt das oben Ausgeführte: der Patientenwille zählt! Aber was gilt, wenn dieser Wille nicht klar erkennbar ist und angezweifelt werden muss? Auf eine Frage zu einer Einwilligung kann durchaus eine formal korrekte Antwort durch den Patienten erfolgen. Dies muss aber noch nicht bedeuten, dass diese Antwort auch dem Patientenwillen entspricht. Die Antwort des Patienten kann missverständlich sein. Die Fragen des Arztes und der Angehörigen können missverständlich sein. Der Patient kann sich in einer Gemütslage befinden, die eine wirksame Einwilligung nicht zulässt, …
Gerichte müssen sich immer wieder mit der vorstehend geschilderten Problematik auseinandersetzen. Dabei bleibt es allerdings bei dem Grundsatz, dass der Patientenwille maßgebend ist. Das bedeutet auch, dass der aktuelle Wille des Patienten in der konkreten Behandlungssituation den Vorrang vor dem Willen von Ärzten und Angehörigen hat. Ein dem aktuellen Willen des Patienten entgegenstehender zuvor geäußerter Wille ist unbeachtlich. Dies muss sogar gelten, wenn der zuvor geäußerte Wille schriftlich und förmlich in einer Patientenverfügung geäußert wurde, § 1901 a Abs. 1 S. 3 BGB alter Fassung bzw. § 1827 Patientenverfügung; Behandlungswünsche oder mutmaßlicher Wille des Betreuten
(1) … Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.
…
(Link: zum Gesetzestext hier im Internetauftritt)§ 1827 Abs. 1 S. 3 neuer Fassung BGB. Dann muss der Patient allerdings einwilligungsfähig sein.
Im Hinblick auf die wirksame Einwilligung ergeben sich für den behandelnden Arzt schwierige Probleme. Er muss den Patienten vor einer Einwilligung ordnungsgemäß aufklären. Der Arzt muss eine wirksame Zustimmung einholen:
Voraussetzung einer wirksamen Einwilligung ist, dass sie nach Verständnis der Sachlage erteilt wurde und der Einwilligende eine zutreffende Vorstellung vom voraussichtlichen Verlauf und den möglichen Folgen des zu erwartenden Eingriffs hat; er muss die nötige Urteilskraft und Gemütsruhe besitzen, um die Tragweite seiner Erklärung zu erkennen und das Für und Wider verständig gegeneinander abzuwägen.
Ohne Anzeichen von Demenz oder eines schweren Schlaganfalls ist das eventuell noch einfach. Aber je komplexer die Behandlungssituation wird, desto höher ist auch der Anspruch an das Verständnis, die Einsichts- und Urteilsfähigkeit des einwilligenden Patienten.
Hier sollten die Ärzte, die im Umgang mit derartigen Situationen geübt sind, mit dem Patienten und den Angehörigen das Gespräch suchen. Dabei sollten sie – sollte die Einwilligungsfähigkeit beachtlich eingeschränkt sein und ein Patientenwille nicht sicher feststellbar sein – auch den mutmaßlichen Willen des Patienten berücksichtigen. Dieses „im Nebel stochernde Suchen“ nach dem Willen des Patienten ist allerdings nicht erforderlich, wenn der Wille zuvor schriftlich in einer Patientenverfügung niedergelegt wurde und/oder zumindest von dem Patienten zuvor schon geäußert wurde. Je mehr Gedanken dazu nachvollziehbar schriftlich klar fixiert wurden, desto eher kann der Wille des Patienten auch Berücksichtigung finden.
An diesem Punkt angelangt können sich noch weitere „quälende Fragen“ im Hinblick auf die Einwilligungsfähigkeit des Patienten ergeben. Der Begriff Einwilligungsfähigkeit bzw. der Einwilligungsunfähigkeit wird zwar ausdrücklich in § 1827 Patientenverfügung; Behandlungswünsche oder mutmaßlicher Wille des Betreuten
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, …
(Link: zum Gesetzestext hier im Internetauftritt)§ 1827 Abs. 1 S. 1 BGB genannt. Diese Vorschrift befasst sich mit der Patientenverfügung und nennt ausdrücklich den Begriff Einwilligungsunfähigkeit. Die Vorschrift des § 1827 BGB enthält aber keine Erklärung dazu, was „Einwilligungsunfähigkeit“ bedeutet. Hier wird nur bestimmt, dass ein Betreuer den Patientenwillen zu erkunden und diesem Willen Geltung und Ausdruck zu verschaffen hat. Die Frage, wann und in welchen Fällen Einwilligungsunfähigkeit vorliegt, lässt § 1827 BGB offen. Der BGH führt dazu in einem 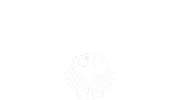 www.juris.bundesgerichtshof.deBeschluss vom 6. Juli 2016 aus:
www.juris.bundesgerichtshof.deBeschluss vom 6. Juli 2016 aus:
[35] aa) Der Bevollmächtigte muss nach § 1901 a Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 BGB prüfen, ob eine eigene, in einer Patientenverfügung im Sinne der Legaldefinition des § 1901 a Abs. 1 Satz 1 BGB niedergelegte Entscheidung des Betroffenen vorliegt und ob diese auf die aktuell eingetretene Lebens- und Behandlungssituation des Betroffenen zutrifft. In diesem Zusammenhang hat der Bevollmächtigte auch zu hinterfragen, ob die Entscheidung noch dem Willen des Betroffenen entspricht, was die Prüfung einschließt, ob das aktuelle Verhalten des nicht mehr entscheidungsfähigen Betroffenen konkrete Anhaltspunkte dafür liefert, dass er unter den gegebenen Umständen den zuvor schriftlich geäußerten Willen nicht mehr gelten lassen will, und ob er bei seinen Festlegungen diese Lebenssituation mitbedacht hat. Dabei hat er gemäß § 1901 b Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 BGB die Maßnahme unter Berücksichtigung des Patientenwillens mit dem behandelnden Arzt zu erörtern; nach § 1901 b Abs. 2 und 3 BGB soll nahen Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, wenn dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist.
Die PEG-Sonde dient der künstlichen Ernährung sowie ggf. der Verabreichung von Schmerzmitteln und weiterer Medikamente.
Für das Legen und die Beibehaltung der PEG-Sonde ist die Einwilligung mit der vorangegangenen Aufklärung erforderlich (zur Einwilligung in die „Beibehaltung“ vgl. ausdrücklich 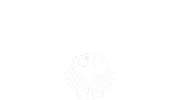 www.juris.bundesgerichtshof.deBeschluss des BGH vom 17. März 2003, XII ZB 2/03, zu III. 2. a).
www.juris.bundesgerichtshof.deBeschluss des BGH vom 17. März 2003, XII ZB 2/03, zu III. 2. a).
Die Aufklärung muss im Hinblick auf die konkrete Behandlungssituation insbesondere
- über Art und Weise des Legens und der damit verbundenen Risiken informieren;
- das Behandlungsziel erkennbar machen;
- die Verweildauer in der Einrichtung verdeutlichen;
- über das Leben mit der Sonde aufklären, insbesondere auf die Gefahr des Refluxes und des Einatmens des Mageninhaltes hinweisen;
- einen Hinweis auf die Möglichkeit der Beendigung der PEG-Versorgung geben.
Die größten Vorteile der PEG-Sonde liegen in der optimalen Sicherung der Versorgung des Kranken. Darüber hinaus können so Schmerzmittel und andere Medikamente verabreicht werden. In vielen Bereichen der Akutversorgung ist die PEG-Sonde unentbehrlich. Dennoch verbleibt es auch hier bei der erforderlichen Einwilligung.
Nachteile der PEG-Sonde sind die Gefahr der Isolation, in nicht seltenen Fällen eine fehlende medizinische Indikation u. a. zum Ziel einer bloßen Pflegeerleichterung (vgl. dazu z. B. Aufsatz von Uhlenbruck „Bedenkliche Aushöhlung der Patientenrechte durch die Gerichte“ in NJW 2003, 1710 ff. (1711). Außerdem sind damit u. a. die Gefahren der Sedierung und Fixierung verbunden.
Ideologisiert werden sollten die Argumente „Verhungern“ und „Verdursten“ nicht. Austrocknen und Auszehren des Körpers sind häufige Begleiterscheinungen des natürlichen Sterbeprozesses (s. o. Uhlenbruck, 1711 mit weiteren Hinweisen).
Die Rechtsprechung hat für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verschiedene weitere Voraussetzungen für eine Einwilligung in eine „Körperverletzung“ entwickelt:
- Kinder unter 14 Jahren sind nicht einwilligungsfähig. In diesem Fall müssen Ärzte die Sorgeberechtigten über die geplante Behandlung aufklären.
- Schwieriger ist schon die Entscheidung, ob Minderjährige von 14–17 Jahren die Einwilligung ohne die Eltern treffen können.
- Weder eine geistige Behinderung noch eine psychische Erkrankung führen per se zur Einwilligungsunfähigkeit. Allerdings können sie die Einsicht und das Urteilsvermögen des Patienten stark herabsetzen.
- Eine Demenz kann den Verlust von Kurzzeitgedächtnis, Merkfähigkeit sowie Orientierung in Raum und Zeit einschränken und so zur Einwilligungsunfähigkeit von Patienten führen.
III. Patientenverfügung
Was beinhaltet der Begriff „Patientenverfügung“?
Eine Patientenverfügung liegt vor, wenn ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt hat, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt, § 1827 BGB – Patientenverfügung; Behandlungswünsche oder mutmaßlicher Wille des Betreuten
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob …
(Link: zum Gesetzestext hier im Internetauftritt)§ 1827 Abs. 1 S. 1 BGB.
Zur Patientenverfügung vergleiche auch den Beitrag:
Ich hoffe, dass Sie möglichst von den zuvor besprochenen Fragestellungen verschont bleiben. Ich mache aber gleichzeitig darauf aufmerksam, dass es ratsam ist, sich mit den angesprochenen Fragen vertraut zu machen und z. B. eine Patientenverfügung sowie eine Vorsorgevollmacht zu verfassen. So können eventuell Leid und Unstimmigkeiten vermieden werden. Ihr Wille muss dann berücksichtigt werden. Dabei können Sie durchaus ohne Bedenken auf Quellen für Muster zurückgreifen, die unentgeltlich von verschiedenen Justizministerien der Länder und des Bundes zum Download bereitgestellt werden. Die entsprechenden Mustertexte müssen Sie gewissenhaft und in Ruhe ausfüllen nachdem Sie sich mit den Fragestellungen eingehend beschäftigt haben.
Die Stiftung Warentest bietet im Internet ein unentgeltliches „Stiftung Warentest
Hier finden Sie die Formulare zu unserem Vorsorge-Set: Die Vorsorgevollmacht, die Regelung des Innenverhältnisses, die Betreuungsverfügung, die Patientenverfügung – und ein Deckblatt für Ihren persönlichen Notfallordner. …
(Link: www.test.de)Vorsorge-Set“ mit Ankreuzformularen für die Vorsorgevollmacht, zur Regelung des Innenverhältnisses, für die Betreuungsverfügung und die Patientenverfügung in der fünften Auflage (Stand: 2021) an. Viele Fragen werden dort beantwortet.
Mit den in dem Internetauftritt und in den Vollmachtsformularen gegebenen Informationen kann ggf. ohne eine weitere Beratung durch einen Notar oder Rechtsanwalt Vorsorge getroffen werden. Für komplexere Fragestellungen – z. B. wenn größeres Vermögen vorhanden ist – kann eine weitere rechtliche Beratung allerdings sinnvoll sein.
Auch in dem Internetauftritt des Bundesjustizministeriums und der Justizministerien einiger Bundesländer werden weitere aktuelle Informationen und Formulare zu Fragen rund um Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten angeboten.
 Vorsorge, Betreuung und Unterbringung - Einführung
Vorsorge, Betreuung und Unterbringung - Einführung
Schreiben Sie einen Kommentar,
stellen Sie eine Frage